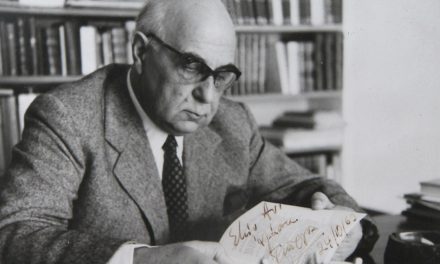Am 22. Februar 2026 setzte das Staatliche Sinfonieorchester Thessaloniki mit einem Konzert in der Elbphilharmonie einen bedeutenden Meilenstein in seiner Geschichte. Die Elbphilharmonie zählt zu den renommiertesten Konzertsälen weltweit und gilt als architektonisches Wahrzeichen des modernen Europas.
Es war der erste Auftritt eines griechischen Orchesters in diesem Haus – ein Ereignis von besonderer kultureller Symbolkraft. Das Konzert war mit rund 2.100 Besucherinnen und Besuchern vollständig ausverkauft. Das Hamburger Publikum würdigte die künstlerische Leistung mit langanhaltendem Applaus und stehenden Ovationen.

Das Programm eröffnete die „Dodekanesische Suite Nr. 1“ von Giannis Konstantinidis, die mit ihren von der griechischen Volksmusik inspirierten Klangfarben mediterrane Akzente in den europäischen Norden brachte.
Im Anschluss interpretierte der vielfach ausgezeichnete österreichische Cellist Jeremias Fliedl das „Cellokonzert Nr. 1“ von Camille Saint-Saëns mit großer Ausdruckstiefe und technischer Brillanz und wurde vom Publikum begeistert gefeiert.
Ein besonderer künstlerischer Höhepunkt war die Mitwirkung von Dr. Nikos Xanthoulis, der die antike griechische Lyra vorstellte, ihre historische Entwicklung erläuterte und ihre klanglichen Möglichkeiten demonstrierte. Gemeinsam mit dem Orchester brachte er die „Ballade von Ephesos“ des international renommierten türkischen Komponisten und Pianisten Fazıl Say zur Aufführung – ein Werk, das im Auftrag des Orchesters entstand.

Den Abschluss des Abends bildete die „Neunte Symphonie“ von Dmitry Shostakovich unter der musikalischen Leitung des international hochgeschätzten Dirigenten Thomas Sanderling, eines engen künstlerischen Weggefährten des Komponisten.
Zu den Ehrengästen des Konzerts zählten der Botschafter der Hellenischen Republik in der Bundesrepublik Deutschland, S.E. Alexandros Papaioannou, der Generalkonsul der Hellenischen Republik in Hamburg, Ioannis Vikelidis, sowie die in Hamburg lebende griechische Musikerin Iro Della. Frau Della gehörte dem Gründungsensemble des Orchesters an, das 1959 unter der Bezeichnung S.O.V.E. (Symphonieorchester von Nordgriechenland) ins Leben gerufen wurde.

Das Konzert fand auf Einladung der deutschen Produktionsfirma Concerts Pamplona GmbH statt, in deren Konzertreihen regelmäßig einige der bedeutendsten Orchester der Welt auftreten.
Quelle, Fotos: www.ertnews.gr